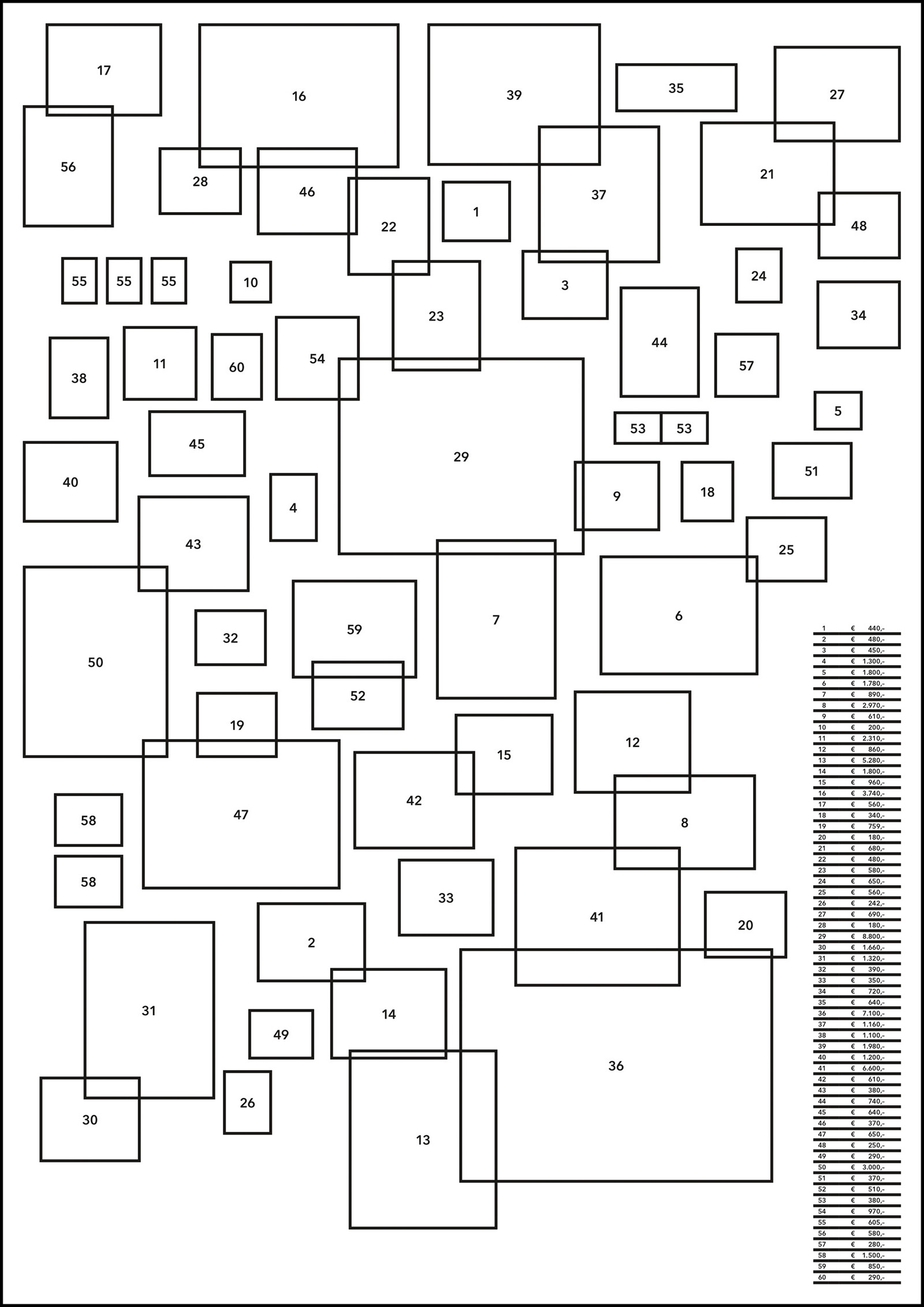In dieser Datenschutzerklärung werden Sie über die Verarbeitungen Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen des Besuchs dieser Website informiert. Die Verarbeitung Ihrer Daten geschieht dabei ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO).
In dieser Datenschutzerklärung werden Sie über die Verarbeitungen Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen des Besuchs dieser Website informiert. Die Verarbeitung Ihrer Daten geschieht dabei ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO).
Bei Ihrem Besuch auf dieser Website werden die Zugriffsdaten in sogenannten Webserver-Logfiles gespeichert. Dabei werden folgende Daten erfasst:
- Datum und Uhrzeit des Zugriffs
- Verzeichnisschutzbenutzer
- Protokolle
- Referrer
- Abgerufene Website
- Übertragene Datenmenge
- Statuscode
- User Agent
- Abgerufener Hostname
- IP-Adresse
Ihre IP-Adresse wird lediglich in gekürzter Form erhoben und gespeichert. Dies geschieht in anonymisierter Form, indem die letzten drei Ziffern entfernt werden. Dadurch scheint Ihre vollständige IP-Adresse nie auf und es ist auch kein Zugang dazu möglich.
Zweck der Datenverarbeitung
Die Verarbeitung dieser Daten ist aus technischen Gründen notwendig. Zudem werden die Zugriffe auf dieser Website statistisch ausgewertet, um das Angebot auf der Website weiter zu verbessern und nutzerfreundlicher zu gestalten, Fehler schneller zu finden und zu beheben sowie Serverkapazitäten zu steuern. Nur wenn ein konkreter Anhaltspunkt für eine rechtswidrige Nutzung dieser Website vorliegt, werden diese Daten in personenbezogener Form zum Zweck der Rechtsverfolgung verwendet.
Rechtsgrundlage
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Zugriffsdaten ist gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO das berechtigte Interesse des Verantwortlichen. Die Erhebung dieser Daten ist ferner aus technischen Gründen notwendig, um Ihnen die Inhalte dieser Website anzeigen zu können. Die Nutzung der Website ist ohne Bereitstellung Ihrer IP-Adresse technisch nicht möglich.
Speicherdauer
Die anonymisierte Angabe zu Benutzername und IP-Adresse wird für die Dauer von maximal 60 Tagen gespeichert. Error-Logs, welche fehlerhafte Seitenaufrufe protokollieren, werden nach sieben Tagen gelöscht. Diese beinhalten neben den Fehlermeldungen die zugreifende IP-Adresse und je nach Fehler die aufgerufene Website.
3. Cookies
3.1 Technische/funktionale Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die eine Wiedererkennung des Nutzers und eine Analyse Ihrer Nutzung dieser Website ermöglichen. Beim Besuch dieser Website werden solche technischen Cookies gesetzt, die unbedingt erforderlich sind, um die Website zu betreiben oder einen Dienst, der von Ihnen ausdrücklich gewünscht wurde, zur Verfügung zu stellen.
Um das Setzen von Cookies generell zu vermeiden, müssen Sie Ihren Browser so einstellen, dass diese nur mit Ihrem Einverständnis erstellt oder abgelehnt werden. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass ohne das Setzen von Cookies Bereiche der Website eingeschränkt oder gar nicht nutzbar sind.
Folgende technischen/funktionalen Cookies werden gesetzt:
Name | Beschreibung | Speicherdauer |
cookieconsent_status | Gibt an, ob der Benutzer das Speichern von Cookies erlaubt hat (allow/deny). Klickt der Benutzer auf „Erlauben“, werden die Google Analytics Cookies gesetzt. Klickt der Benutzer auf „Nicht erlauben“, wird das Cookie „a-disable“ gesetzt. | 1 Jahr |
ga-disable | Wird gesetzt, wenn der Benutzer im Cookie-Banner auf „Nicht erlauben“ klickt | 1 Jahr |
Rechtsgrundlage
Rechtsgrundlage für die Setzung der technischen/funktionalen Cookies ist gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO das berechtigte Interesse des Verantwortlichen. Diese Cookies sorgen dafür, dass diese Website, beziehungsweise der Dienst, ordnungsgemäß funktioniert. Das heißt, ohne diese Cookies ist diese Website nicht wie vorgesehen nutzbar. Diese Art von Cookies wird ausschließlich von dem Betreiber der Website verwendet (First Party Cookies) und sämtliche Informationen, die in den Cookies gespeichert sind, werden nur an diese Website gesendet.
3.2 Performance Cookies
Performance-Cookies sammeln Informationen darüber, wie diese Website genutzt wird. Diese Cookies helfen dabei festzustellen, ob und welche Unterseiten dieser Website besucht werden und für welche Inhalte sich die Nutzer besonders interessieren. Erfasst werden dabei die Anzahl der Zugriffe auf eine Seite, die Anzahl der aufgerufenen Unterseiten, die auf der Website verbrachte Zeit, die Reihenfolge der besuchten Seiten, welche Suchbegriffe Nutzer auf diese Seite geführt haben, das Land, die Region und gegebenenfalls die Stadt von welcher aus der Zugriff erfolgt, sowie den Anteil von mobilen Endgeräten, die auf diese Websites zugreifen.
Auf dieser Website wird folgender Webanalysedienst genutzt:
3.3 Google Analytics
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“) verwendet im Rahmen des Webanalysedienstes Google Analytics Cookies, die eine Analyse Ihrer Nutzung der Website ermöglichen. Aus den Daten können unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Die Cookies ermöglichen es, Ihren Browser wieder zu erkennen. Die erhobenen Daten werden jedoch nicht genutzt, um Sie persönlich zu identifizieren, und nicht mit Ihren personenbezogenen Daten zusammengeführt.
Dabei werden nachstehende Cookies gesetzt und genutzt:
Name | Beschreibung | Speicherdauer |
_ga — Google | Website Analytics | 2 Jahre |
_gat — Google | Website Analytics | 1 Minute |
_gid — Google | Website Analytics | 24 Stunden |
Google wird diese Daten im Auftrag des Verantwortlichen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen ihm gegenüber zu erbringen.
Die mit durch Google durchgeführten Analysen der Websitenutzung verbundenen Datenverarbeitungen dienen dem gemeinsamen Zweck, die Website an die Bedürfnisse und Wünsche der Nutzer optimal anzupassen.
Google behält sich vor, die Daten auch auf Servern in den USA zu verarbeiten und lässt insoweit die EU-Standardvertragsklauseln zur Anwendung kommen, die ein angemessenes Datenschutzniveau garantieren sollen. In den USA besteht aktuell kein ausreichendes Datenschutzniveau. Insbesondere können US-Behörden auf Daten zugreifen, ohne dass Ihnen gerichtlich verfolgbare Rechtsbehelfe hiergegen zustehen. Da US-Behörden nicht an die EU-Standardvertragsklauseln gebunden sind, holen wir über den Cookie-Banner Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung in den USA ein. Somit erfolgt die Verarbeitung aufgrund Ihrer erteilten Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Zur Gewährleistung einer anonymisierten Erfassung von IP-Adressen wurde der Quelltext von Google Analytics um den Code „anonymizeIP“ erweitert. Die IP-Adressen werden so nur gekürzt weiterverarbeitet, um einen Personenbezug auszuschließen. Auch die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Sie können die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) durch Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google nicht nur durch Ihre Browsereinstellungen, sondern darüber hinaus dadurch verhindern, dass Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plug-In herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Durch Klicken dieses Links wird ein Opt-Out Cookie gesetzt, der verhindert, dass Ihre Daten von Google erfasst werden. Löschen Sie den jeweiligen Opt-Out Cookie nicht, solange Sie Ihren Widerspruch aufrechterhalten möchten. Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz von Google können Sie unter folgenden Links abrufen:
marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de
policies.google.com/privacy
4. Drittanbieter
Diese Website enthält Verlinkungen zu anderen Websites, auf deren Inhalt und die dortige Datenverarbeitung der Verantwortliche keinen Einfluss hat. Er übernimmt darum für diese Inhalte keinerlei Verantwortung. Für die Datenschutzinformationen, die Inhalte und Richtigkeit der dort bereitgestellten Informationen ist ausschließlich der jeweilige Anbieter der verlinkten Website verantwortlich.
4.1 YouTube
Es werden YouTube-Videos in diese Website eingebunden. YouTube wird von Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA betrieben. Erst wenn Sie die Videos abspielen, werden Daten übertragen. Hinweise und Informationen zum Datenschutz bei YouTube können Sie der Datenschutzrichtlinie von Google entnehmen: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
4.2 Instagram
Über diese Website gelangen Sie zu Instagram. Diese Funktionen werden angeboten durch die Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA und integriert. Wenn Sie in Ihrem Instagram-Account eingeloggt sind können Sie durch Anklicken des Instagram-Buttons die Inhalte dieser Website mit Ihrem Instagram-Profil verlinken. Dadurch kann Instagram den Besuch dieser Website Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Es wird darauf hingewiesen, dass der Verantwortliche dieser Website keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Instagram hat. Genaueres zu den Datenschutzrichtlinien zu Instagram erfahren Sie unter: https://www.instagram.com.
5. Ihre Rechte
Falls Sie der Meinung sind, dass diese Website bei der Verarbeitung Ihrer Daten gegen österreichisches oder europäisches Recht verstößt, so bitten wir um Kontaktaufnahme unter info@eggenberger.studio um allfällige Fragen aufklären zu können. Sie haben selbstverständlich auch das Recht, sich bei der österreichischen Datenschutzbehörde bzw. bei einer Aufsichtsbehörde innerhalb der EU zu beschweren.
read less